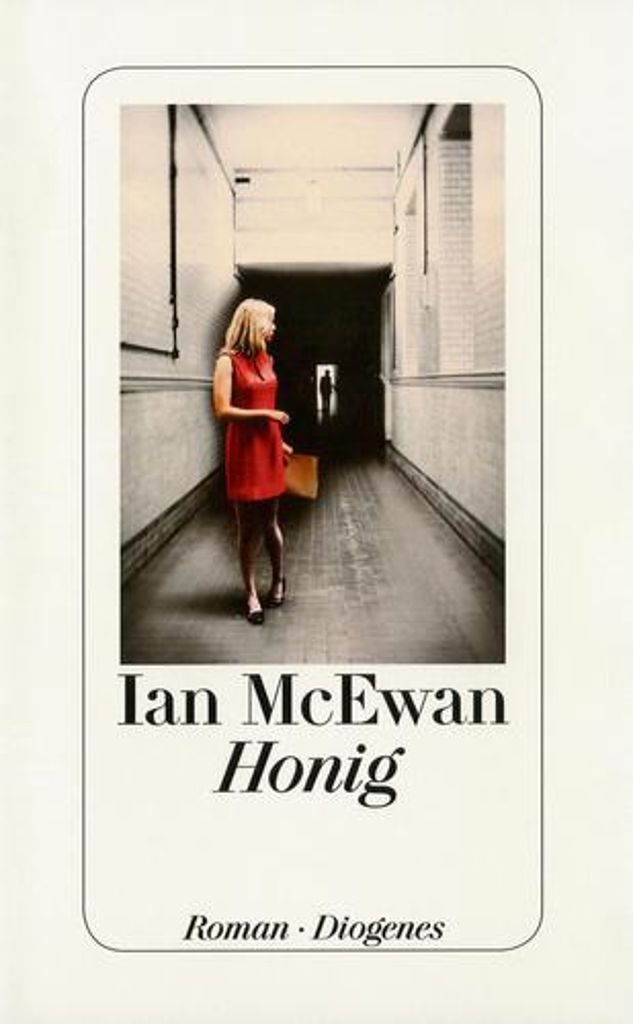Wie so oft beschreibt der Autor schicksalshafte Wackelpartien von Menschen in einer Lebenswelt, die nach Sicherheit verlangt. Wie so oft schreibt er darüber in einer geschmeidig-glasklaren, so vernünftigen wie sinnlichen, auch schon mal erotischen Prosa, die den Leser mit kultivierter Sanftheit anfasst und ihn unbehindert durch den Text trägt. Viel amüsant Kluges und manch poetisch Schönes unterläuft dem 65-jährigen Autor dabei wie von ungefähr. Und: Neuerlich glänzt er nicht mit einer wendungsreich spannenden, lakonisch komponierten, überraschend endenden Handlung allein; wie in seinem Klassiker "Abbitte" schreibt er in "Honig" auch übers Schreiben, einen Text über einen Text.
Was immerhin sicher zu sein scheint: Wer hier in Ich-Form schreibt, ist eine junge Frau, Serena, Anfang der Siebziger Anfang zwanzig, schön, selbstständig, von sachlicher Intelligenz und in Sachen Männer zu Romanzen mit offenem Ausgang bereit. Sie ist eine Leserin, unersättlich, zur hochgeschwinden Bewältigung enormer Tagespensen in der Lage. Darum lässt sie sich von einem älteren Liebhaber an den MI5 vermitteln, den Inlandsgeheimdienst, der gerade, mitten im Kalten Krieg, das Projekt "Honig" startet: Über ein angeblich unabhängiges Förderstipendium will er junge Wissenschaftler und Schriftsteller finanzieren, um ihnen, als ahnungslosen Agitatoren "im Krieg der Ideen", die Veröffentlichung antikommunistischer Arbeiten zu ermöglichen.
Serenas Zielperson: ein junger Autor, noch unsicher im Vertrauen auf sein Talent. Durch Charme und falsche Angaben gewinnt sie Tom für die Operation und für sich. Denn obwohl es in Agentengeschichten meist nicht so kommt, wie's kommen muss, verliebt sie sich, naturgemäß. In den kalten Fluren ihrer Dienststelle gerät sie darum unter Druck; und auch in ihrer Beziehung zum eifrig schriftstellernden Tom findet sie keine Ruhe. Ungebremst manifestiert sich seine Inspiration in einer Reihe von brillant-bizarren Stoffentwürfen, die McEwan ohne Weiteres selbst zu ausgewachsenen Novellen hätte fortentwickeln können. Währenddessen muss auch Serenas Anfangslüge fortzeugend neue Fiktionen gebären. Denn natürlich darf Tom nichts von "Honig" wissen. Irgendwann aber weiß auch Serena nicht alles, was Tom über Serena weiß. "Die Grenze zwischen dem, was Leute sich einbilden, und dem, was tatsächlich der Fall ist", so hat man ihr gesagt, "kann sehr unscharf werden."
1972? Manchmal scheint es, als sollte die Geschichte heute spielen. Vom "Ende des Kalten Krieges" ist die Rede und von amerikanisch-russischen Gegensätzlichkeiten; vom Kapitalismus, der vielleicht "die Zivilisation zu Fall bringt"; Terrorismus - hier der IRA - droht mit Allgegenwart; und allgegenwärtig treiben die Geheimdienste sinistre Spiele im Verborgenen. Aber nicht auf eine moderne Politikanalyse im Spiegel naher Vergangenheit legt Ian McEwan es an. Er benutzt, unaufdringlich in seiner menschenkundigen Psychologie, die Konfrontation von verdeckter Staatsmacht und einer auf Öffentlichkeit dringenden Kultur, um das Paradox auszuleuchten, das sich durch den Zwang zum Geheimnis und das Recht auf Wahrheit ergibt. Die vermeintliche Realität der Menschen zermahlt er in einem System von Täuschung, Fremdbestimmung und Verrat, "wunderbar in sich geschlossen" wie der "dialektische Materialismus".
Aus "Abbitte" kennt man den souveränen Umgang des Autors mit mehreren Ebenen der Fiktion. Ist also auch diese Geschichte wieder: ein Spiel? Vielleicht geht sie ja doch richtig "gut aus". Für Gefühle, die sich erst durchs geschriebene Wort verwirklichen, ist Ian McEwan ein virtuoser Spezialist: für die Erschaffung von Leben, das sich in Gestalt von Literatur erfüllt. Michael Thumser
-----
Ian McEwan: Honig. Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Diogenes-Verlag, 462 Seiten, gebunden, 22,90 Euro.
Buch-Tipp