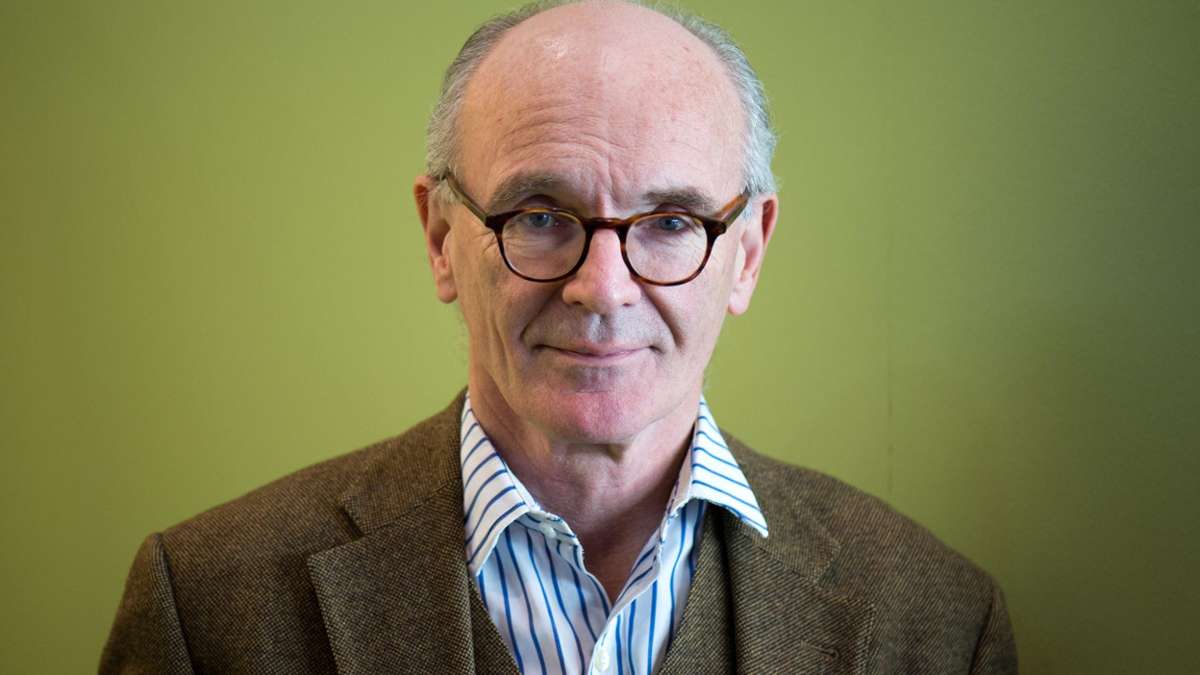Frankfurt/Main - Die Ideen für seine Romane holt sich Martin Mosebach gerne auf Reisen. In Griechenland ist er jedoch gerade gewesen, um sein neues Buch Korrektur zu lesen. Es erscheint bei Rowohlt im August - drei Wochen nach seinem 65. Geburtstag, den Mosebach am 31. Juli feiert.
Der neue Roman «Mogador» lehnt sich mit dem Titel an den alten kolonialen Namen von Essaouira an. Die Stadt an der marokkanischen Atlantikküste kennt Mosebach von eigenen Aufenthalten gut. Das Buch spielt zwar in der Gegenwart, beschwört aber zugleich den kulturellen Reichtum dieser von der Subsahara stark beeinflussten Region, die vom Fundamentalismus immer stärker bedroht ist.
«Es ist eine Trauer damit verbunden», sagt Mosebach. Der tief im Katholizismus verwurzelte Traditionalist fühlt sich nach eigenen Worten frommen Muslimen in ihrer Demut spirituell durchaus verbunden. Den «puritanischen» Islamismus hält er aber dagegen für eine «Karikatur der Religion».
Mosebach, einer der ganz großen Erzähler der deutschsprachigen Literatur, hat schon immer ein Faible für die wundersamen Geschichten des Orients und des indischen Subkontinents gehabt. Die Titel seiner Werke wie etwa «Die Türkin» zeugen davon.
Zugleich ist Mosebach ein Mann der Künste, der zur aussterbenden Spezies der Universalgebildeten gehört. Er schreibt Opernlibretti, Filmbücher und ist auch der Malerei sehr verbunden. Sein Schreibstil ist fein-ironisierend und elegant - das altmodische Wort «erlesen» passt ganz gut. Es wundert daher nicht, dass dieser Stil mit seinen vielen Erzählsträngen stets polarisiert hat. Was die einen für verschmuckten Manierismus halten, bietet anderen den großen Lesegenuss.
Auch sein letzter Roman «Blutbuchenfest» (2014) hat die Kritik gespalten. Darin kontrastiert er in einer Gesellschaftskomödie das Leben einer bosnischen Putzfrau mit dem oberen Bürgertum in Frankfurt - inklusive all seiner Hochstapler, Geschäftemacher und Lebemänner. Mosebach weiß, wovon er schreibt: Er wuchs als Sohn eines Arztes im großbürgerlichen Frankfurter Westend auf. In seiner Heimatstadt lebt er - wenn er nicht gerade auf Reisen ist - auch heute noch.
Mit dem Schreiben begann Mosebach erst nach seinem Jurastudium. Sein großes Familienepos «Westend» (1992), das die Veränderungen des Viertels über Generationen hinweg dokumentiert, ist ein literarisches Glanzstück. Doch der Erfolg stellte sich bei Mosebach erst viel später ein. Seit der Verleihung des Georg-Büchner-Preises im Jahr 2007 ist er aber auch einer großen Öffentlichkeit bekannt.
Profiliert hat sich Mosebach auch als streitbarer Freigeist, der in Essays immer wieder öffentlich gegen den Zeitgeist Position bezieht. Der Erzkatholik war einer der ersten, der sich für die Wiedereinführung des lateinischen Ritus in der Liturgie stark machte. Auch Papst Franziskus steht Mosebach kritisch gegenüber, da er eine «Verunklarung» der katholischen Leitlinien befürchtet.
Mosebach will aber in keine der üblichen Schubladen gesteckt werden - mit Recht. Vom Schreiben will er auch nach dem Eintritt ins Rentenalter nicht lassen. Es ist für ihn zur «Lebensform» geworden. «Ich empfinde die Notwendigkeit, was sich an Eindrücken ansammelt, in irgendeiner Form in eine Erzählung zu gießen.» In der Regel lässt sich dafür der Autor etwa zwei bis drei Jahre Zeit. Eine Idee für den nächsten Roman hat er schon.
Der neue Roman «Mogador» lehnt sich mit dem Titel an den alten kolonialen Namen von Essaouira an. Die Stadt an der marokkanischen Atlantikküste kennt Mosebach von eigenen Aufenthalten gut. Das Buch spielt zwar in der Gegenwart, beschwört aber zugleich den kulturellen Reichtum dieser von der Subsahara stark beeinflussten Region, die vom Fundamentalismus immer stärker bedroht ist.
«Es ist eine Trauer damit verbunden», sagt Mosebach. Der tief im Katholizismus verwurzelte Traditionalist fühlt sich nach eigenen Worten frommen Muslimen in ihrer Demut spirituell durchaus verbunden. Den «puritanischen» Islamismus hält er aber dagegen für eine «Karikatur der Religion».
Mosebach, einer der ganz großen Erzähler der deutschsprachigen Literatur, hat schon immer ein Faible für die wundersamen Geschichten des Orients und des indischen Subkontinents gehabt. Die Titel seiner Werke wie etwa «Die Türkin» zeugen davon.
Zugleich ist Mosebach ein Mann der Künste, der zur aussterbenden Spezies der Universalgebildeten gehört. Er schreibt Opernlibretti, Filmbücher und ist auch der Malerei sehr verbunden. Sein Schreibstil ist fein-ironisierend und elegant - das altmodische Wort «erlesen» passt ganz gut. Es wundert daher nicht, dass dieser Stil mit seinen vielen Erzählsträngen stets polarisiert hat. Was die einen für verschmuckten Manierismus halten, bietet anderen den großen Lesegenuss.
Auch sein letzter Roman «Blutbuchenfest» (2014) hat die Kritik gespalten. Darin kontrastiert er in einer Gesellschaftskomödie das Leben einer bosnischen Putzfrau mit dem oberen Bürgertum in Frankfurt - inklusive all seiner Hochstapler, Geschäftemacher und Lebemänner. Mosebach weiß, wovon er schreibt: Er wuchs als Sohn eines Arztes im großbürgerlichen Frankfurter Westend auf. In seiner Heimatstadt lebt er - wenn er nicht gerade auf Reisen ist - auch heute noch.
Mit dem Schreiben begann Mosebach erst nach seinem Jurastudium. Sein großes Familienepos «Westend» (1992), das die Veränderungen des Viertels über Generationen hinweg dokumentiert, ist ein literarisches Glanzstück. Doch der Erfolg stellte sich bei Mosebach erst viel später ein. Seit der Verleihung des Georg-Büchner-Preises im Jahr 2007 ist er aber auch einer großen Öffentlichkeit bekannt.
Profiliert hat sich Mosebach auch als streitbarer Freigeist, der in Essays immer wieder öffentlich gegen den Zeitgeist Position bezieht. Der Erzkatholik war einer der ersten, der sich für die Wiedereinführung des lateinischen Ritus in der Liturgie stark machte. Auch Papst Franziskus steht Mosebach kritisch gegenüber, da er eine «Verunklarung» der katholischen Leitlinien befürchtet.
Mosebach will aber in keine der üblichen Schubladen gesteckt werden - mit Recht. Vom Schreiben will er auch nach dem Eintritt ins Rentenalter nicht lassen. Es ist für ihn zur «Lebensform» geworden. «Ich empfinde die Notwendigkeit, was sich an Eindrücken ansammelt, in irgendeiner Form in eine Erzählung zu gießen.» In der Regel lässt sich dafür der Autor etwa zwei bis drei Jahre Zeit. Eine Idee für den nächsten Roman hat er schon.